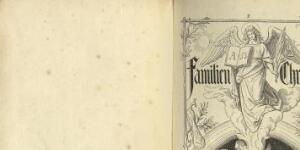Fotos von Waldemar Möller und Kriegerdenkmal mit seinem Namen
Waldemar Möller, geb. am 27. Dezember 1889 in Hadersleben (nach Volksabstimmung 1920 gehörte Haderslev zu Dänemark), gest. am 11. September 1918. Foto von Waldemar Möller mit Kameraden auf dem Schießplatz Wahn (vermutlich Truppenübungsplatz Wahn bei Köln), 1913.
Foto vom Kriegerdenkmal auf der Krusenkoppel in Kiel (heute sind nur noch Reste erhalten). Auf der Gefallenenliste ist auch Waldemar Möller vermerkt.
Waldemar Möller war Anstreicher; zu Hause wurde eine Art Platt-dänisch gesprochen. Er fiel kurz vor Kriegsende bei Straßburg.
Other
Imperial Forces
Women
CONTRIBUTOR
F&F
DATE
1913 - 1918
LANGUAGE
deu
ITEMS
5
INSTITUTION
Europeana 1914-1918
PROGRESS
METADATA
Discover Similar Stories
Fotos und Auszeichnungen von Vizewachtmeister Waldemar Dittmar
14 Items
Erinnerungen an meinen Großvater Waldemar Dittmar, geb. am 5. September 1877 in Cobstedt. Fotos und Auszeichnungen von Vizewachtmeister Waldemar Dittmar, Feldartillerie-Regiment 33, u.a. Ernennung zum Vize-Wachtmeister 1907, Dienstauszeichung 1908 und Verleihung des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse, 1918 in Metz.
Notizbuch mit Namen und Adressen der Mitgefangenen von Alwin Metz
20 Items
Der spätere Lehrer Alwin Metz, geb. am 2. Januar 1896 in Oppurg, Thüringen, absolvierte vom 7. Januar 1914 bis zum 1. Oktober 1914 seine Reservistenausbildung an verschiedenen Orten. Als Kriegsfreiwilliger meldete er sich 1914 zum Heeresdienst. Er diente im 9. Bataillon des 224. Reserve-Infanterie-Regiments und war zunächst bis zum 18.12.1914 an der Westfront in Frankreich im Einsatz. Im Dezember 1914 wurde er in die Karpaten verlegt. Bei einem Gefecht gegen russische Soldaten in der Nacht zum 1. Februar 1915 erlitt er einen Unterleibsdurchschuss und wurde bei Tuchla gefangengenommen. Sein Lazarett befand sich in Stryj, in der Nähe von Lemberg. Metz wurde nach seinem Aufenthalt im Lazarett in Stryj über Brody, Kiew und die Krim nach Moskau gebracht (März 1915). Ab November 1915 war er in Blagoweschtschensk am Amur (Благове́щенск) interniert, nahe der chinesischen Grenze. Aus seinen Aufzeichnungen gehen weitere Zwischenstationen in Petropawlosk, Omsk, Tobolsk, Tjumen und Nowo Nikolajewsk hervor (August bis November 1915). In Blagoweschtschensk war er Leiter der Lagerbibliothek (Bücherwart und Inventarverwalter) und gründete auch einen Chor oder eine Laienspielgruppe. Metz war maßgeblich an der Gestaltung des Lagerlebens beteiligt und an der Freizeitgestaltung der Mitgefangenen. Im Juli 1916 berichtete er über Lungen- und Rippenfellentzündungen, die er aber überstanden hatte. Seine Eltern schickten ihm Geld und Tabak. Während Metz´ Gefangenschaft in Russland, befand sich bei seinen Eltern in Oppurg ein russischer Kriegsgefangener, der sich mit einem Brief vom 1. Februar 1918 an Alwin wendete. Spätestens ab Mai 1919 befindet sich Alwin Metz in dem Kriegsgefangenenlager in Zairkutny-Gorodok bei Irkutsk. Alwin Metz wurde während seines Rückwegs in die Heimat mehrfach zurückgeschickt. Wahrscheinlich war es nicht der offizielle Rücktransport, sondern eine Flucht aus dem Lager, bei der er wieder gefangen genommen und ins Lager zurückgeschickt wurde. 1920 verließ Alwin Metz endgültig das Lager und kehrte am 2. Juli 1920 nach Hause zurück. Vier Tage später, am 6. Juli 1920, entließ man ihn offiziell aus der Armee. Während seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft, vom 4. Juni bis zum 2. Juli 1920, auf dem Weg von Sibirien nach Thüringen zurück, führte er ein Tagebuch, dass er in alter Gabelsberger Stenografie verfasste. Zurück in der Heimat unterhielt Alwin Metz in Briefen Kontakt zu ehemaligen Mitgefangenen. Ihm wird nachträglich am 1. Dezember 1921 vom Weimarischen Krieger- und Vereinsbundes die Kriegsdenkmünze 1914/18 des Kyffhäuser-Bundes sowie im Juni 1921 das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen. Er erzählte, dass er, wenn es überhaupt mal Zucker im Lager für die Gefangenen gab, sich dann ein ganzes Stück Zucker in den Mund gesteckt, es möglichst lange im Mund behalten und so seinen Tee getrunken hatte. 1947 ist Alwin Metz von Russen gefangengenommen worden und wurde in ein Auffanglager bei Buchenwald gebracht. Dort erlitt er eine Pferdefleischvergiftung und wurde während eines Transports in diesem Zustand aus dem Zug geworfen. Metz hielt zahlreiche Vorträge über seine Kriegsgefangenenzeit in Sibirien vor interessierten Bürgern und Einwohnern in Oppurg und in Neustadt und als Lehrer vor Schülern. Er war bei verschiedenen Vereinen aktiv (Imker, Geflügelzüchter, Kaninchenzüchter). Alwin Metz zog als kriegsbegeisterter Soldat in den Krieg, um gegen die Russen als Feinde zu kämpfen und kehrte nach über fünf Jahren in Gefangenschaft als Freund der Russen und des russischen Reiches zurück. || Kleines Notizbuch mit den Namen und Adressen der Mitgefangenen von Alwin Metz, Maße: ca. 10 x 5 cm. Namen der Mitgefangenen: Leop. Karl Watzeck, Julius Philippson, Sepp Schmid, Leutnant Pistor, Arno Surber, Otto Weigand, Karl Nikolai, Fritz Paczoch, Dr.phil. Fritz Naudieth, Erwin Schattschneider, Josef Neumann, Gustav Wirth, Wilhelm Giesecke, Robert Schmidt, Hugo Temme, Rudolf Lehmann, Heinrich Kröger, R. Kerner, Carl Wernwick, Ferd. O´Zilack, Karl Bentzien, Walter Arlt (?). Zwei Namen sind nicht zu entziffern. Die letzten zwei Doppelseiten enthalten Notizen auf russisch. Teils sind auch die Regimenter der Mitgefangenen vermerkt, außerdem enthält das Notizbuch Vermerke über Schulden, die Metz entweder gegenüber anderen Mitgefangenen oder umgekehrt hatte.
Bibel mit Familienchronik von Friedrich und Charlotte Kleine-Möller
10 Items
Eine Bibel mit Familienchronik, die mein Vater in den Trümmern Berlins 1952 oder 1954 gefunden hat. Die im Jahr 1904 gedruckte Bibel gehörte dem Ehepaar Friedrich Kleine-Möller und Charlotte, geb. Kettler. Es sind Geburtsdaten, Heiratsdatum (10. Mai 1907) etc. eingetragen. Friedrich Kleine-Möller wurde am 17. Oktober 1914 schwer verwundet und kam in ein Lazarett, das einen Tag später von den Russen geräumt wurde. Er wurde mehrmals operiert und ist am 17. September 1915 an einem Herzschlag verstorben. Das Datum ist laut Familienchronik nach russischer Zeit, d.h. nach dem Julianischen Kalender. Nach Gregorianischem Kalender ist er am Donnerstag, den 30. September 1915 in Tambar, Russland, verstorben. || Eine Bibel, die zu Beginn die Familienchronik der Familie Kleine-Möller beinhaltet und mit christlichen Bildmotiven und Bibelzitaten verziert ist.