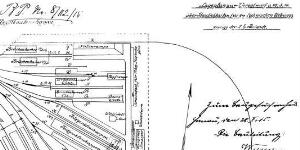Die Familie Holibka mit Mitarbeitern der k.u.k.-Eisenbahn
Schwarz-weiß-Foto der Familie mit Mitarbeitern der k.u.k.-Eisenbahn.
Das Familienfoto zeigt die Großeltern mütterlicherseits. Der Großvater Karl Holibka war bei der k.u.k.-Eisenbahn und mit der Familie vorübergehend in Westpreußen stationiert. Der genaue Ort ist leider nicht bekannt. Karl ist am 25.04.1880 geboren und Auguste, geb. Larisch am 04.09.1882. Ebenfalls abgebildet sind zwei der vier Kinder (erstes und zweites Kind von links).
Die Mutter, die nicht auf dem Foto abgebildet ist, hat erzählt, dass sie als Kinder bei der Streckenkontrolle im Zug mitfahren durften und das sehr aufregend fanden. Die Mutter hat auch von der Freundschaft zu einer jüdischen Familie berichtet, mit der sie sich sehr gut verstanden haben und zusammen gerne Matzen aßen.
CONTRIBUTOR
Renate Schlüter
DATE
1918
LANGUAGE
deu
ITEMS
1
INSTITUTION
Europeana 1914-1918
PROGRESS
METADATA
Discover Similar Stories
Der Eisenbahn-Neben-Ersatzpark Hanau (E.N.E.P.) 1914 - 1918
1 Item
Mit dem Einmarsch der Eisenbahn-Regimenter Nr.3 im Jahre 1910 und dem Nr.2 drei Jahre später war die Aufstellung der 2. Königlich-Preußischen Eisenbahn-Brigade in Hanau am Main abgeschlossen. Für diese Verkehrstruppe waren von 1908 bis 1913 zwei große, jeweils ca. 2.400 Mann fassende Kasernen nebst zweier Wasserübungsplätze, einem Übungsdepot, einem Kriegsdepot und einer Brückengrube geschaffen worden. Alles war durch eine 18 km lange Feldbahn der Spurweite 600 mm, zur Hälfte als Dreischienengleis (600 und 1435 mm) ausgelegt, miteinander verbunden. Die Depotbauten waren bei der Mobilmachung weitgehend fertig gestellt, jedoch wurden noch bis Mitte 1916 weitere Hallen und massive Schuppen errichtet, um die umfangreichen Materialbestände der Feldeisenbahntruppe einlagern zu können. Für die Mobilmachung lagerten bereits in Friedenszeiten in den ausgedehnten Anlagen des Kriegsdepots der 2. Eisenbahn-Brigade, das waren immerhin rund 80 Hochbauten, für die Ausrüstung von 32 Eisenbahn-Baukompanien, zwei Eisenbahn-Betriebskompanien und zwei Eisenbahn-Arbeiterkompanien das gesamte Handwerkszeug und Gerät. Außerdem lagerten zehn Einheiten Feldbahnmaterial, die aus je 7 Feldbahnlokomotiven, 6 Tendern, 55 Feldbahnwagen und 10 km montiertem Feldbahngleis von 600 mm-Spur und Ersatzteilen bestand. Zusammengenommen also 70 Feldbahnlokomotiven, 60 Tender, 550 Feldbahnwagen und 100 km Gleis - bereits zu Friedenszeiten (die gleiche Anzahl an Feldbahnmaterial stand den beiden Eisenbahnregimentern zu Ausbildungszwecken im Übungsdepot zur Verfügung). Diese Einheiten wurden gleich zu Beginn des Krieges durch vertragliche Lieferungen der Fabriken um weitere 30 Einheiten ergänzt. Wie so eine Lieferung vonstatten ging, lässt sich am Beispiel der Heeresfeldbahnlokomotiven mit den Nummern 709 - 743 darlegen. Die Depotverwaltung der 1. Eisenbahn-Brigade in Rehagen/Klausdorf bei Berlin orderte bei Krauss-Maffei in München, am 29. Mai 1916, insgesamt 44 Maschinen der Brigadelokomotive des Typs D, zum Stückpreis von 25.445,- Mark. Liefertermin war der 13. November 1916. Wegen Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung gelangten diese Maschinen erst zwischen dem 21. und 30. Dezember zur Auslieferung. Als Lieferanschrift wurde die Depotverwaltung des Eisenbahn-Neben-Ersatz-Parks Hanau Nord angegeben. Außerdem setzten mit Kriegsbeginn die vertraglichen Lieferungen von Werkzeug und Gerät zur Ergänzung und für neu aufgestellte Formationen ein. Für das gesamte Feld- und Vollbahnmaterial wurde der Eisenbahn-Nebenersatzpark, für das Handwerkszeug und Gerät die Feldgeräte-Depots der Eisenbahn-Regimenter 2 und 3 bestimmt. Das gesamte neue Material an Lokomotiven und Wagen musste auf seine Brauchbarkeit praktisch erprobt werden und die aus dem Felde kommenden Lokomotiven und Wagen wurden repariert und gebrauchsfähig zum Versand wiederhergestellt. Insgesamt trafen im Hanauer Eisenbahn-Nebenersatzpark im Laufe der Kriegsjahre etwa 3.700 Feldbahnlokomotiven, 280 Tender, 58.000 Feldbahnwagen, 55 Motordraisinen (Benzollokomotiven), 60 Bahnmeisterwagen, 10.970 km Gleise, 50.000 Weichen und 2,5 Millionen hölzerne Eisenbahnschwellen ein. Davon wurden an die Formationen der Eisenbahntruppe ins Feld gesandt: 3.200 Lokomotiven, 53.000 Feldbahnwagen, 7.600 km Gleis, 46.000 Weichen, 200 Tender. Der Rest lagerte noch nach dem 11. November 1918 in Hanau. Zu diesen Beständen kamen dann während der Räumung der besetzten Gebiete etwa 5.500 normalspurige Eisenbahnwagen, deren Inhalt mit größter Eile entladen werden musste. Tagelang war die zweispurige Trasse Hanau-Nord - Friedberg von wartenden Rücktransporten blockiert - Zug an Zug standen sie hintereinander, bis zum etwa 5 km entfernten Bahnhof Bruchköbel und darüber hinaus. Eine ordnungsgemäße Lagerung dieser Bestände war nicht möglich, so dass in jenen Tagen große Werte Wind, Wetter und vor allem Diebstahl ausgesetzt waren. Man sprach in einschlägigen Kreisen vom sogenannten „Hanauer Lager“. Der kleine Bestand an Arbeitskräften vor dem Krieg war im Laufe der Kriegsjahre erheblich angewachsen. Eine Parkkompanie, die während der großen Offensiven auf 1.000 bis 1.200 Mann ergänzt werden musste, hatte die erheblichen Arbeiten zu verrichten. Nach dem Zusammenbruch von 1918 wurde sie durch 1.200 bis 1.400 Arbeiter ersetzt, die in monatelanger Arbeit die ungeheuren Materialbestände ordneten. Später wurden diese an die Bauindustrie abgegeben, als Reparationsleistungen an die Siegermächte abgeführt oder gar auf deren Befehl verschrottet. Heute ist von dem Eisenbahn-Nebenersatzpark noch der Gleisbauhof der Deutschen Bahn erhalten - die Depotbauten an der Ruhrstraße sind weitgehend geschleift worden, wie z.B. 1993 der letzte von einstmals drei Wassertürmen abgebrochen werden musste. Nur auf dem Areal der mittlerweile in Konkurs gegangenen Firma Naxos-Union sind noch Reste des alten Kriegsdepots zu sehen. Auszug aus meinem Buch Von Feldbahnen und Kasernenbauten - Die Geschichte der Hanauer Eisenbahn-Regimenter 1907 bis 1919, Jens Gustav Arndt, März 2013, 320 Bilder, 192 Seiten. || || Map || Lageplan || Lageplan des Hanauer Eisenbahn-Neben-Ersatz-Park der 2. Eisenbahn-Brigade || Middle East || Eastern Front || Western Front || Balkans || Italian Front
Die Feldzüge des k.u.k. Infanterieregiments 92
18 Items
Der Vater von Franz Wenisch diente im 92. Infanterie-Regiment der österreichisch-ungarischen Armee. Das Regiment hatte seit seiner Aufstellung 1883 seinen Ergänzungsbezirk in Böhmen. Die Friedens-Garnisonen waren in Theresienstadt und Josephsstadt. Das Ergänzungs-Bezirkskommando war in Komotau (heute Chomutov, Tschechische Republik). Das Infanterieregiment 92 hat für Komotau eine besondere Bedeutung. Es war nicht nur das Stamm- Militär für Komotau, sondern auch sein Marsch Aller Ehren ist Österreich voll ist gemeinhin als Komotauer Marsch bekannt. Im Ersten Weltkrieg war das Regiment 92 an der Ostfront und an der Balkanfront. Es nahm 1914 am Herbstfeldzug gegen Serbien und Mazedonien und 1915 am Mackensen-Feldzug und am montenegrinischen Feldzug teil. 1916 war es an der Frühjahrsoffensive gegen Italien beteiligt. Das 2. Bataillon war in diesem Jahr in Südtirol als Verstärkung der italienischen Front eingesetzt. Am 16. und 17. November 1917 überquerten Teile des 92er Regimentes die Piave und brachen in die feindlichen Stellungen ein. Dort gerieten Teile des Regimentes in italienische Kriegsgefangenschaft. In der Junischlacht 1918 nahmen Teile des Infanterieregiments 92 an der Junioffensive teil, welche erfolglos verlief. Im Oktober und November 1918 verteidigten die es einen 1,5 Kilometer breiten Frontabschnitt bei Bergo Malanotte. Am 3.11.1918 erhielten die Truppen den Befehl, die Kämpfe einzustellen. Die Italiener machten Hunderttausende Österreicher an Kriegsgefangenen. Die Heeresleitung befahl den Bewaffneten Rückzug. Über Linz, Passau, Regensburg und Eger kehrten das Regiment nach Komotau zurück. Am 17.11.1918 um 8.00 Uhr fuhr die 2. Staffel in die Stadt ein. Ein Freund des Vaters hingegen befand sich 1915 mit seiner Einheit an der Ostfront und erlebte dort die Brussilow-Offensive. Diese Offensive der russischen Armee an der Ostfront des Ersten Weltkrieges in Galizien, der Bukowina und Wolhynien begann am 4. Juni 1916 und endete nach großen Gebietsgewinnen am 20. September desselben Jahres. Die nach dem verantwortlichen General Alexei Alexejewitsch Brussilow benannte Offensive, stellte den größten militärischen Erfolg Russlands im Ersten Weltkrieg dar, doch beschleunigten die hohen Verluste die Demoralisierung des russischen Heeres. Sie waren ein Hauptmotiv für den Kriegseintritt Rumäniens an der Seite der Entente. || Die 18 Feldpostkarten zeigen Ansichten von verschiedenen europäischen Kriegsschauplätzen sowohl im Westen als auch im Osten und vom Balkan. Eine Postkarte zeigt zudem Kapitänleutnant Otto Weddigen (1882-1915), den Kommandaten der U-Boote U9 und U29, das mitsamt seiner Besatzung am 18. März 1915 von der HSM Dreadnought versenkt wurde.